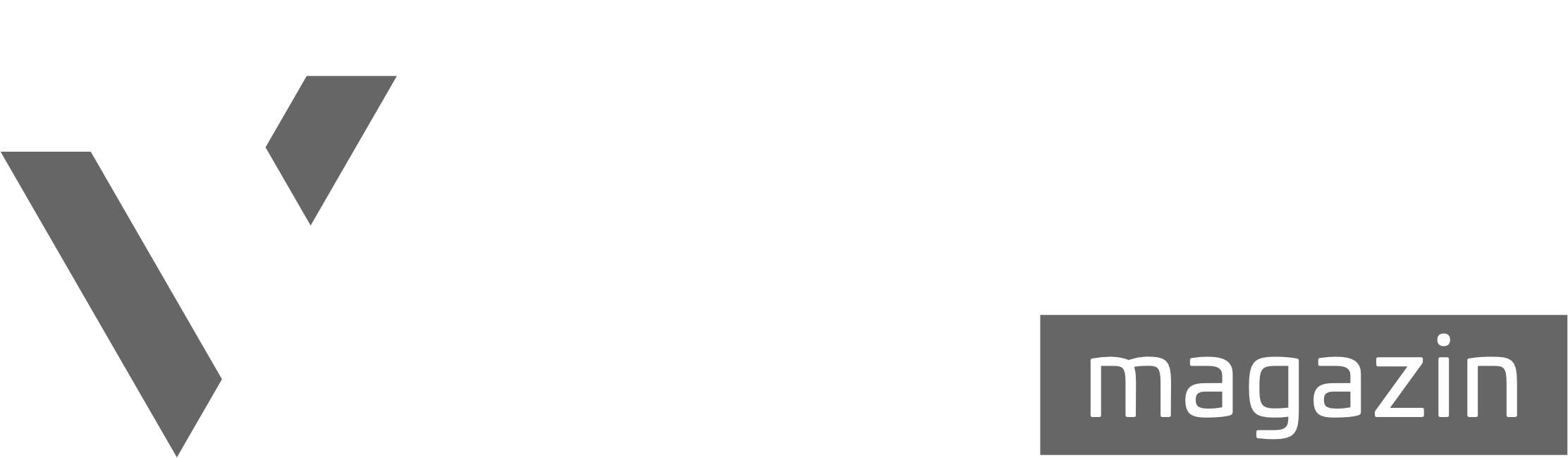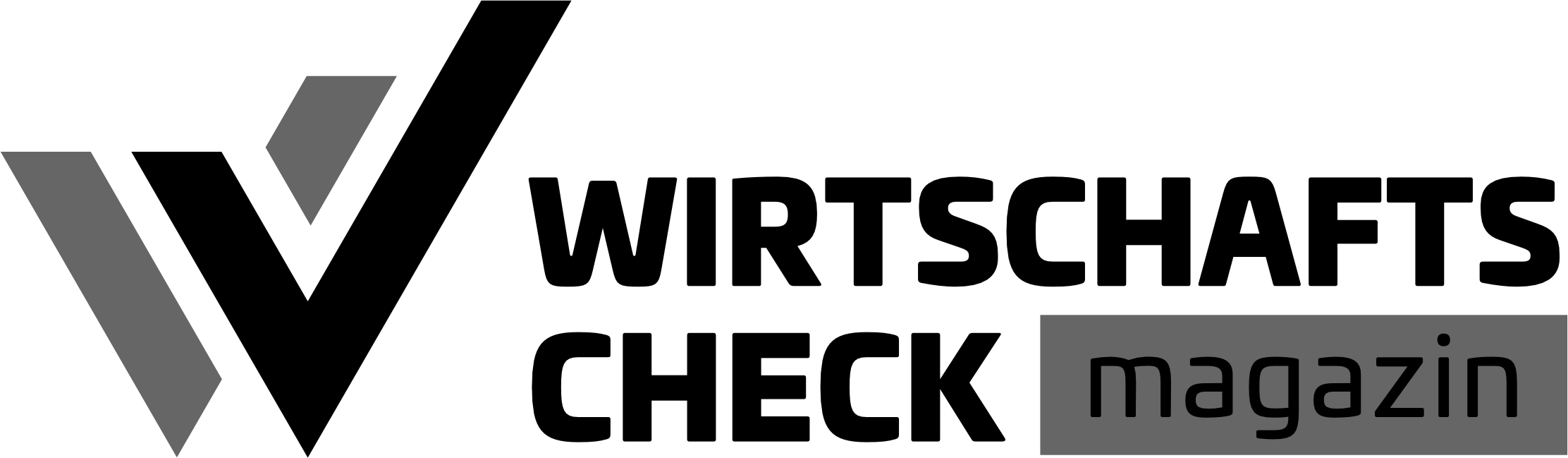In einer Zeit, in der Organisationen ständig unter Veränderungsdruck stehen, wird die Fähigkeit zur Selbstreflexion zur Schlüsselressource. Wer sich im Wettbewerb behaupten will, braucht mehr als Prozesse – er braucht Menschen, die lernen dürfen. Eine konstruktive Fehler- und Feedbackkultur ist dabei keine weiche Kompetenz, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor. Doch wie lässt sich diese Kultur konkret verankern? Wirtschaftscheck spricht mit der systemischen Coachin Doris Neuherz über mutige Führung, lernende Teams und den Unterschied zwischen Lippenbekenntnis und gelebter Praxis.
Porträt: Doris Neuherz
Doris Neuherz ist systemische Coachin aus der Südsteiermark mit Schwerpunkt auf menschenzentrierter Führung, agiler Haltung und nachhaltigem Kulturwandel. Sie begleitet Führungskräfte, Teams und Organisationen durch Transformationsprozesse, bei denen nicht Methoden im Vordergrund stehen, sondern Haltungen, Kommunikation und Feedback-Kompetenz. Besonders geschätzt wird sie für ihre Fähigkeit, komplexe Veränderungsvorhaben kontextsensibel und strukturiert zu begleiten – ob im Bildungsbereich, im Handel oder in sozialen Einrichtungen. Ihr Coachingansatz setzt auf Reflexion, klare Sprache und die Entwicklung einer tragfähigen Führungskultur. Dabei geht es ihr nicht um kurzfristige Optimierung, sondern um langfristige Wirksamkeit auf individueller wie organisationaler Ebene, beispielsweise bei der Otto-Group, für die sie über 15 Jahre lang tätig war.
Frau Neuherz, warum ist eine bewusste Fehler- und Feedbackkultur heute wichtiger denn je?
Doris Neuherz: Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert: Technologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Um mit dieser Dynamik mithalten zu können, brauchen Unternehmen eine Kultur, die Lernen ermöglicht. Fehler- und Feedbackkultur sind dabei zwei zentrale Hebel. Fehler ermöglichen Lernen, Feedback schafft Klarheit, Vertrauen und Entwicklung. Organisationen, die beides aktiv fördern, sind widerstandsfähiger und innovativer.
Wo sehen Sie heute die größten Herausforderungen?
Doris Neuherz: Viele Unternehmen sprechen von einer offenen Kultur, aber in der Realität herrschen oft noch Angst, Schuldzuweisungen oder eine „Fehlervermeidungs-Mentalität“. Feedback wird entweder vermieden oder als einmaliges Mitarbeitergespräch institutionalisiert. Doch Feedback lebt vom Alltag, von Resonanz, von gegenseitiger Wertschätzung.
Was genau verstehen Sie unter einer gelebten Fehlerkultur?
Doris Neuherz: Eine gelebte Fehlerkultur bedeutet, dass Fehler nicht tabuisiert oder vertuscht werden, sondern dass sie als Teil des Lernprozesses akzeptiert und reflektiert werden. Es geht nicht darum, Fehler gutzuheißen, sondern aus ihnen zu lernen. Das erfolgt systematisch, ehrlich und lösungsorientiert.
Ein Beispiel aus der Praxis: In einem Unternehmen, mit dem ich arbeite, führte ein Softwarefehler zu einer verspäteten Auslieferung. Anstatt den Schuldigen zu suchen, setzte das Team eine sogenannte „Postmortem Analyse“ ein. Jede Abteilung schilderte, wo und warum ein Informationsverlust passiert war. Ergebnis: Die Teams führten ein einfaches Eskalationsprotokoll ein, das transparent, wertschätzend und teamübergreifend greift.
Wie kann eine Führungskraft eine positive Fehlerkultur fördern?
Doris Neuherz: Indem sie selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Wenn eine Führungskraft auch eigene Fehler offen anspricht und zeigt, was sie daraus gelernt hat, schafft sie psychologische Sicherheit im Team. Es braucht einen sicheren Raum, in dem sich Menschen mit all ihren Ideen, Zweifeln und Irrtümern zeigen dürfen.
Wie definieren Sie eine gesunde Feedbackkultur?
Doris Neuherz: Eine gesunde Feedbackkultur ist kein Tool, sondern eine Haltung. Sie basiert auf Wertschätzung, Klarheit und auf dem Wunsch, gemeinsam besser zu werden. Feedback bedeutet nicht Kritik, sondern Rückmeldung. Feedback ist ein Geschenk, wenn es ehrlich und respektvoll gegeben wird.
Was erleben Sie in Teams häufig im Umgang mit Feedback?
Doris Neuherz: Zwei Extreme: Entweder Feedback wird aus Angst oder Harmoniebedürfnis vermieden oder es wird ungefiltert und verletzend kommuniziert. Beides ist kontraproduktiv. Gute Feedbackkultur lebt von bewusster Sprache, Timing und vor allem Beziehung.
Ein Praxisbeispiel: In einem Unternehmen begleite ich Teams, die regelmäßig sogenannte „Feedback-Walks“ machen: 1:1-Spaziergänge, bei denen die Mitarbeitenden Feedback auf Augenhöhe austauschen – jenseits von Meetingräumen. Das hat die Gesprächskultur im gesamten Unternehmen nachhaltig verändert.
Welche Rolle spielt Führung in dieser Kulturentwicklung?
Doris Neuherz: Führungskräfte sind die Kulturträger Nummer eins. Ihre Haltung wirkt sich direkt auf das Verhalten der Teams aus. Wenn eine Führungskraft keine Rückmeldung einholt oder defensiv auf Kritik reagiert, sendet sie ein starkes Signal – nämlich gegen eine offene Kultur. Gute Führung bedeutet: Feedback geben UND annehmen zu können.
Wie kann man als Führungskraft besser Feedback annehmen?
Doris Neuherz: Indem man den Perspektivwechsel übt. Feedback ist keine Abwertung, sondern eine Sichtweise. Wer sich darauf einlässt, gewinnt Klarheit über blinde Flecken. Es hilft, aktiv nach Feedback zu fragen: „Was brauchst du von mir als Führungskraft, damit du noch besser arbeiten kannst?“ Diese Frage allein verändert schon viel.
Was raten Sie Unternehmen, die ihre Kultur verbessern wollen?
Doris Neuherz: Setzen Sie nicht nur auf Tools oder neue Formate, sondern auf Beziehung, Haltung und Dialog. Kulturentwicklung braucht Zeit, Mut und Konsequenz. Feedback wird damit zum zentralen Motor für Entwicklung auf allen Ebenen: Individuell, im Team und im Unternehmen. Beginnen Sie im Kleinen: Ein tägliches Check-in mit der Frage „Was lief heute gut und was nicht?“ kann Wunder wirken. Entscheidend ist, dass Kultur nicht von oben verordnet, sondern gemeinsam gestaltet wird.
Herzlichen Dank, Frau Neuherz, für das interessante Interview.
Überblick: Zentrale Inhalte des Interviews mit Doris Neuherz
| Thema | Kernaussage | Praxisbeispiel |
|---|---|---|
| Fehlerkultur | Fehler sind Lernanlässe und dürfen nicht tabuisiert werden. | Postmortem-Analyse bei Softwarefehlern zur teamübergreifenden Prozessoptimierung. |
| Feedbackkultur | Feedback ist ein Beziehungstool, kein Kontrollinstrument. | „Feedback-Walks“ außerhalb von Meetings fördern Dialog auf Augenhöhe. |
| Führung & Vorbildfunktion | Führungskräfte prägen Kultur durch ihr eigenes Verhalten. | Offenes Eingeständnis von Fehlern durch Führung erhöht psychologische Sicherheit im Team. |
| Kulturelle Herausforderungen | Offene Feedbackkultur wird oft behauptet, aber selten konsequent gelebt. | Angst und Harmoniebedürfnis blockieren ehrliche Rückmeldung. |
| Feedback geben & annehmen | Rückmeldung erfordert Klarheit, Respekt und gutes Timing – in beide Richtungen. | Die Frage „Was brauchst du von mir als Führungskraft?“ wirkt als kultureller Hebel. |
| Kulturentwicklung im Unternehmen | Erfolgt nicht durch Tools, sondern durch Beziehung, Haltung und Dialog. | Tägliches Check-in mit Reflexionsfragen als niederschwelliger Einstieg. |
Fazit: Fehlerkultur als strategische Ressource in der Transformation
Das Gespräch mit Doris Neuherz zeigt, dass Fehler- und Feedbackkultur weit mehr sind als kommunikative Nebenaktivitäten – sie sind zentrale Zukunftskompetenzen in Zeiten kontinuierlicher Veränderung. Unternehmen, die mutige Führung, wertschätzende Rückmeldung und transparente Fehleranalyse verankern, schaffen psychologische Sicherheit und Innovationskraft. Entscheidend ist dabei nicht die Einführung neuer Tools, sondern ein kultureller Wandel hin zu einer lernenden Organisation. Führungskräfte spielen dabei eine Schlüsselrolle: Sie sind Vorbild, Richtungsgeber und Impulsgeber für gelebte Offenheit. Wer Feedback als Beziehungsgeste versteht und Fehler als Lernchancen nutzt, stärkt nicht nur die Teamkultur, sondern auch die strategische Resilienz der gesamten Organisation.
Passende Artikel:
Agile Leadership: Warum ein Wachstumsmindset der Schlüssel ist – von Doris Neuherz
Doris Neuherz über die Transformation der Businesslandschaft