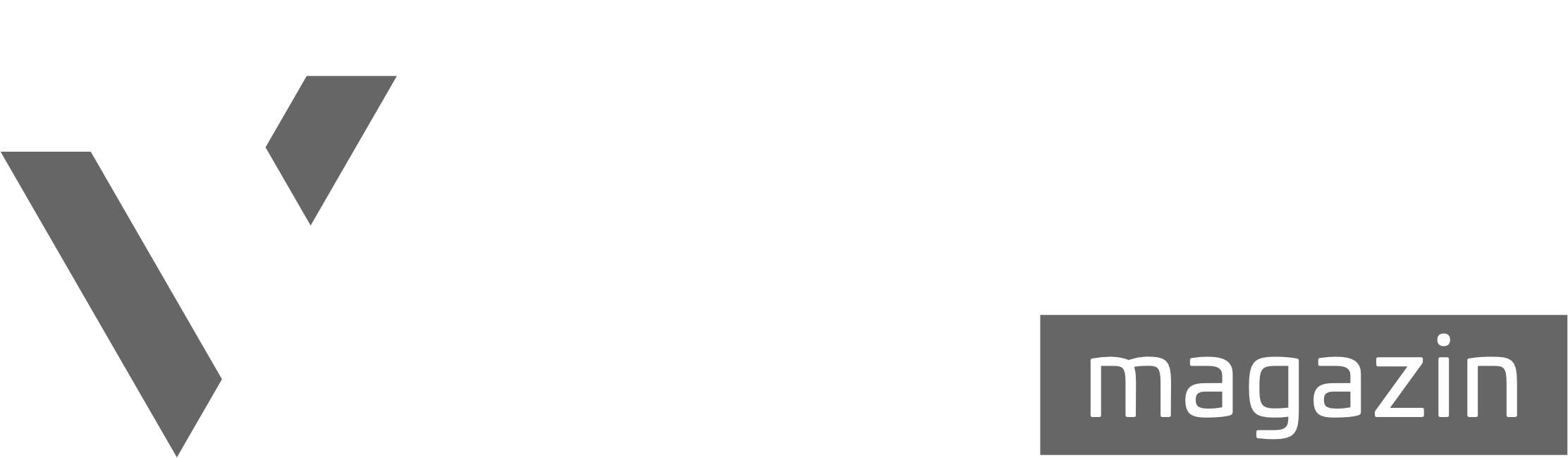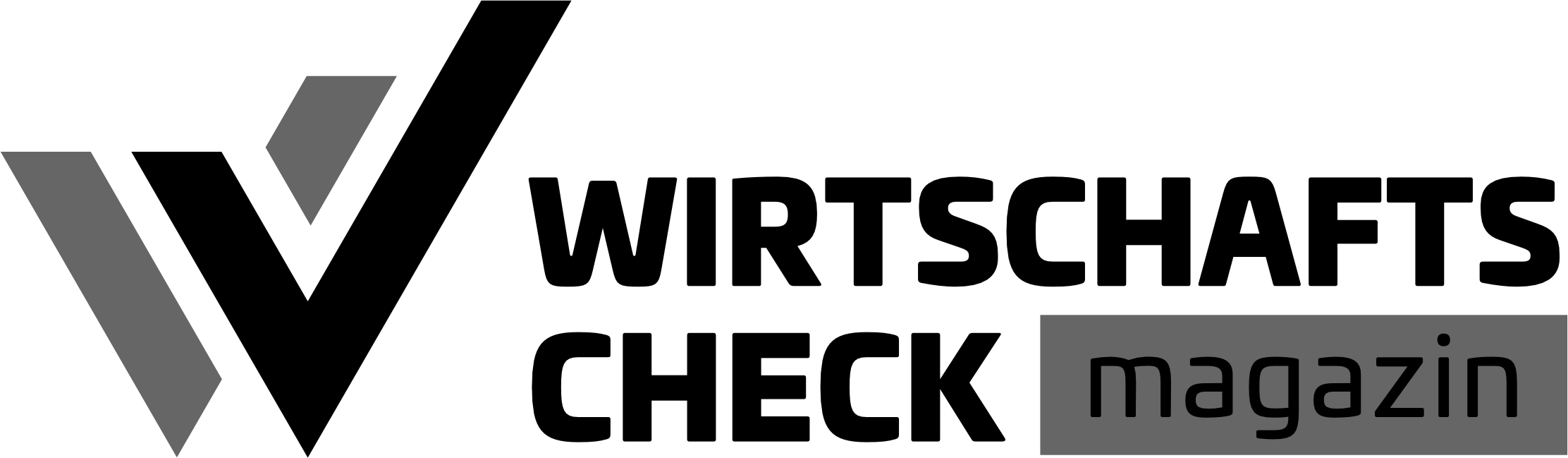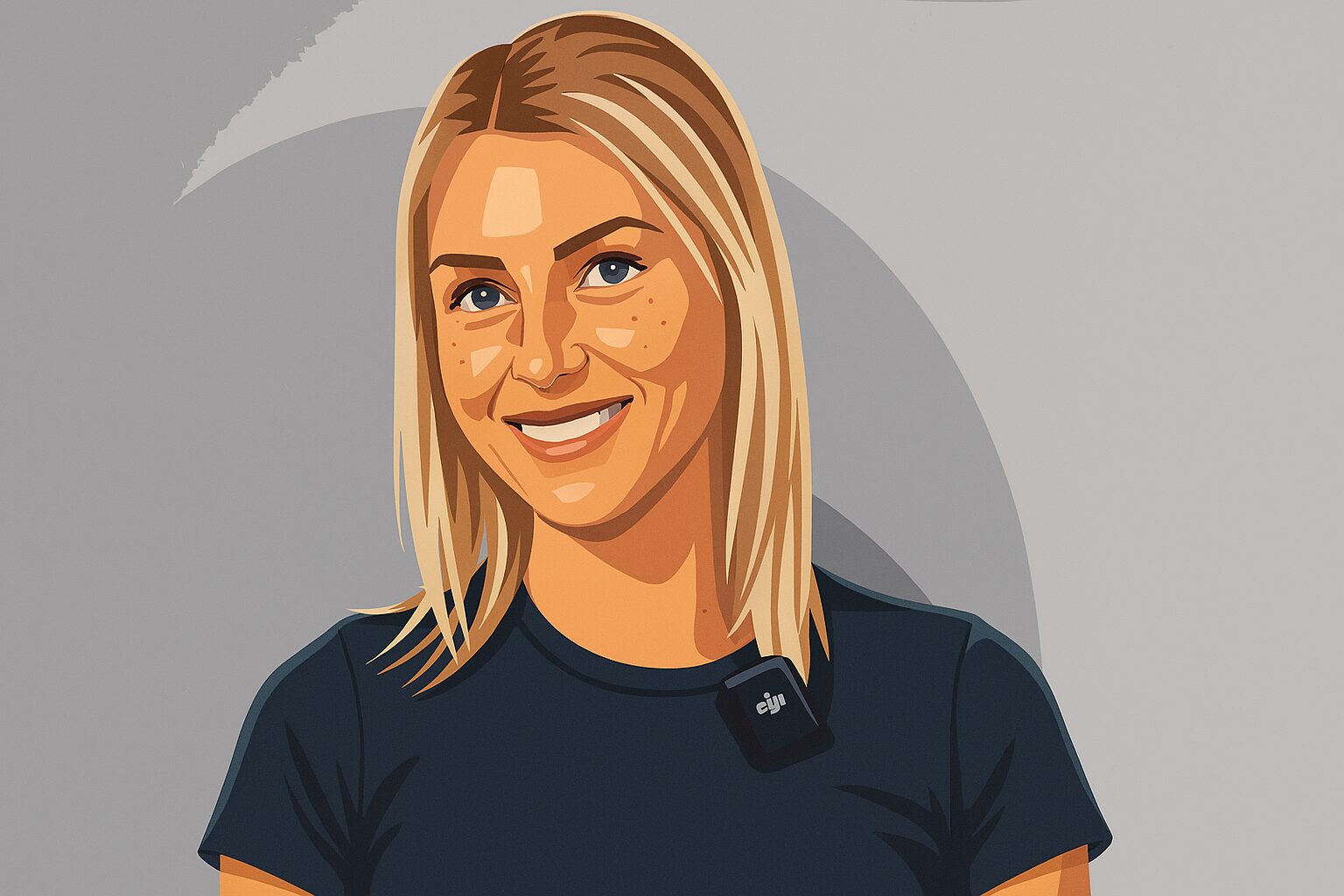Wenn Kollegen systematisch schikaniert, ausgegrenzt oder verbal attackiert werden, spricht man von Mobbing. Es handelt sich dabei um ein wiederholtes und bewusstes Verhalten, das auf die psychische oder physische Beeinträchtigung einer Person abzielt. Betroffene leiden unter ständigen Angriffen auf ihre Würde, was langfristige gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann. Doch ist Mobbing am Arbeitsplatz strafbar? Diese Frage stellt sich nicht nur für Betroffene, sondern auch für Arbeitgeber und HR-Abteilungen.
Mobbing am Arbeitsplatz: Kein Straftatbestand – aber juristisch relevant
Das deutsche Strafgesetzbuch kennt keinen eigenständigen Straftatbestand namens „Mobbing“. Dennoch kann Mobbing strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn bestimmte Tatbestände erfüllt sind.
Schikanieren oder Diskriminieren hat Grenzen
- Beleidigung nach § 185 StGB: Wer am Arbeitsplatz gemobbt wird und dabei gezielt durch Worte herabgewürdigt oder beschimpft wird, kann sich auf diesen Paragraphen berufen. Er schützt die betroffene Person vor verbalen Angriffen und ermöglicht eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe als Konsequenz für die systematische Schikane.
- Üble Nachrede nach § 186 StGB: Dieser Paragraph greift, wenn Kollegen oder Vorgesetzte bewusst unwahre Tatsachen über jemanden äußern, die dessen Ruf schädigen. Für Mobbingopfer bedeutet das: Auch vermeintlich harmlose Andeutungen am Arbeitsplatz können strafbar sein, wenn sie geeignet sind, Anfeindung und psychischen Druck zu erzeugen.
- Verleumdung nach § 187 StGB: Verbreitet jemand bewusst falsche Informationen über eine betroffene Person, um deren Ansehen zu zerstören, liegt eine strafbare Verleumdung vor. Im Kontext von Mobbing am Arbeitsplatz handelt es sich dabei um eine besonders perfide Form der Schikane, die auch eine fristlose Kündigung des Täters nach sich ziehen kann.
Wenn Handlungen von Kollegen oder Vorgesetzten zu weit gehen
- Körperverletzung nach § 223 StGB: Wird ein Opfer von Mobbing am Arbeitsplatz auch körperlich attackiert – etwa durch Schubsen oder gar Schläge –, fällt dies unter diesen Paragraphen. Körperliche Übergriffe sind nicht nur ein klarer Verstoß gegen das Arbeitsrecht, sondern begründen auch Schadensersatzansprüche.
- Nötigung nach § 240 StGB: Drohungen, Erpressung oder die erzwungene Zustimmung zu bestimmten Handlungen durch Kollegen oder Vorgesetzte sind Fälle von Nötigung. Diese Form des Bossings stellt eine strafbare Handlung dar und verpflichtet Arbeitgeber zur Einhaltung der Fürsorgepflicht gegenüber dem Mobbingopfer.
- Stalking nach § 238 StGB: Wenn ein Täter über einen längeren Zeitraum hinweg die betroffene Person verfolgt, ausspioniert oder belästigt, liegt strafbares Stalking vor. Auch im beruflichen Umfeld gilt dies als ernstzunehmende Form des Mobbings, die häufig eine Krankschreibung wegen Mobbing und rechtliche Schritte nach sich zieht.
Diese Straftatbestände greifen oft dann, wenn Mobbing eine gewisse Intensität erreicht oder mit konkreten Handlungen verbunden ist. Daher ist Mobbing am Arbeitsplatz indirekt strafbar, sobald es in einen strafrechtlich relevanten Kontext übergeht.
Zivilrechtliche Konsequenzen für Arbeitgeber und Mobber
Auch ohne direkten Straftatbestand kann Mobbing zivilrechtliche Folgen haben. Arbeitnehmer haben Anspruch auf Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte. Werden diese verletzt, drohen:
- Schadensersatzforderungen gegen den Täter
- Schmerzensgeldforderungen gegen den Arbeitgeber
- Abmahnungen und Kündigungen bei nachgewiesenem Fehlverhalten
Unternehmen haben die gesetzliche Pflicht, ihre Mitarbeiter vor psychischer Belastung zu schützen. Ignorieren Vorgesetzte Hinweise auf Mobbing, kann dies zur Haftung des Arbeitgebers führen.
Wie erkennt man Mobbing im Betrieb?
Nicht jeder Konflikt ist Mobbing. Um gezielt einschreiten zu können, muss man klare Kriterien erkennen. Zu den typischen Mobbinghandlungen zählen:
- Ständige Kritik oder Abwertung der Arbeitsleistung
- Soziale Isolation im Team
- Verbreitung falscher Informationen oder Gerüchte
- Entzug wichtiger Arbeitsaufgaben
- Öffentliche Bloßstellung
Mobbing ist ein Prozess, kein einmaliges Ereignis. Die Regelmäßigkeit und Dauer sind entscheidend für die Bewertung.
Mobbing dokumentieren und Beweise sichern
Wer Mobbing erlebt, sollte systematisch Beweise sammeln. Dazu gehören:
- Ein Mobbing-Tagebuch mit Datum, Uhrzeit und Beschreibung der Vorfälle
- E-Mails, Notizen und Zeugenaussagen
- Medizinische Atteste bei gesundheitlichen Folgen
Diese Dokumentation ist essenziell, um arbeitsrechtliche oder strafrechtliche Schritte einzuleiten. Ohne Beweise ist eine Klage oder Anzeige oft nicht erfolgversprechend.
Rechtsweg: Anzeige erstatten oder vor das Arbeitsgericht ziehen?
Betroffene haben zwei Möglichkeiten:
- Strafanzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft, wenn ein Verdacht auf eine Straftat besteht
- Zivilklage beim Arbeitsgericht, z. B. auf Unterlassung, Schmerzensgeld oder Kündigungsschutz
Oft empfiehlt sich die Kombination beider Wege, insbesondere wenn der Arbeitgeber seiner Schutzpflicht nicht nachkommt.
Welche Rolle spielt der Betriebsrat?
Der Betriebsrat ist gesetzlich dazu verpflichtet, bei Mobbing aktiv zu werden. Laut Betriebsverfassungsgesetz (§ 84 ff.) können Arbeitnehmer sich vertrauensvoll an den Betriebsrat wenden. Dieser kann Gespräche vermitteln, Verfahren einleiten und im Zweifel rechtliche Schritte unterstützen.
Was Arbeitgeber tun müssen: Prävention und Intervention
Arbeitgeber sind verpflichtet, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der Mobbing keinen Platz hat. Dazu zählen:
- Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter
- Einführung eines Beschwerdesystems
- Klare Unternehmensrichtlinien gegen Diskriminierung und Mobbing
Maßnahmen zur Früherkennung und offenen Kommunikation senken die Wahrscheinlichkeit für eskalierende Konflikte deutlich.
Wie rechtlich vorgehen?
Wer Mobbing am Arbeitsplatz erkennt, sollte nicht zögern, rechtliche Schritte einzuleiten. Denn: Mobbing am Arbeitsplatz ist keine Bagatelle, sondern kann unter bestimmten Umständen eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts, eine Diskriminierung am Arbeitsplatz oder ein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) darstellen. Betroffene sollten daher frühzeitig einen Fachanwalt für Arbeitsrecht oder einen erfahrenen Rechtsanwalt aufsuchen, um den individuellen Fall von Mobbing rechtlich bewerten zu lassen.
Je nach Situation kann eine Abmahnung, eine Versetzung, ein Antrag auf Schadensersatz oder sogar eine fristlose Kündigung rechtlich durchgesetzt werden – vorausgesetzt, die Beweislast ist gut dokumentiert. Hierbei helfen auch interne Stellen wie der Personalrat, die häufig erste Anlaufstelle bei systematischer Belästigung, Bossing oder Psychoterror am Arbeitsplatz sind. Das Gleichbehandlungsgesetz stärkt insbesondere Menschen, die durch Merkmale wie Geschlecht, Herkunft oder Alter diskriminiert werden.
Wichtig ist: Wer Mobbing stoppen möchte, sollte frühzeitig rechtliche Schritte einleiten, um den Arbeitsplatz zu schützen und Folgeerkrankungen zu vermeiden.
Psychologische Folgen von Mobbing nicht unterschätzen
Langfristiges Mobbing kann zu schwerwiegenden psychischen Erkrankungen führen, darunter:
- Depressionen
- Angststörungen
- Burnout-Syndrom
- Schlafstörungen
Diese gesundheitlichen Auswirkungen können auch einen Anspruch auf Berufsunfähigkeit oder eine Reha-Maßnahme begründen.
FAQ: Häufige Fragen zu Mobbing am Arbeitsplatz und rechtlicher Lage
Ist Mobbing am Arbeitsplatz strafbar?
Nicht direkt, aber viele Mobbinghandlungen erfüllen strafbare Tatbestände wie Beleidigung oder Körperverletzung.
Was tun bei Mobbing?
Fälle dokumentieren, Gespräch mit dem Arbeitgeber oder Betriebsrat suchen, gegebenenfalls Anzeige erstatten oder klagen.
Wie viel Schmerzensgeld bei Mobbing?
Je nach Einzelfall und Beweislage können zwischen 2.000 und 50.000 Euro zugesprochen werden.
Fazit: Klare Haltung gegen Mobbing am Arbeitsplatz erforderlich
Auch wenn „Mobbing“ kein eigener Straftatbestand ist, steht Betroffenen ein umfassender rechtlicher Schutz zur Verfügung. Arbeitgeber sind in der Pflicht, bei Hinweisen aktiv zu werden und Strukturen zu schaffen, die psychischer Gewalt vorbeugen. Nur durch klare Regelwerke, transparente Kommunikation und juristische Konsequenzen kann das Problem nachhaltig bekämpft werden.
Artikel, die Sie interessieren könnten:
5 Ebenen der Selbstfürsorge – so werden Sie eins mit sich selbst
Kraftvolle Affirmationen – welche sind empfehlenswert?
Retreat Urlaub – 3 professionelle Anbieter
Growth Mindset – 5 Sofortmaßnahmen für mehr Erfolg